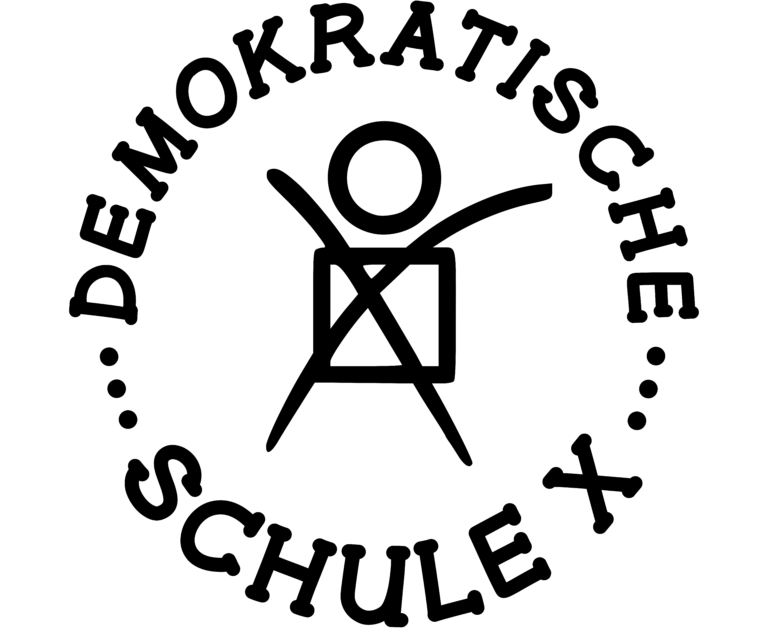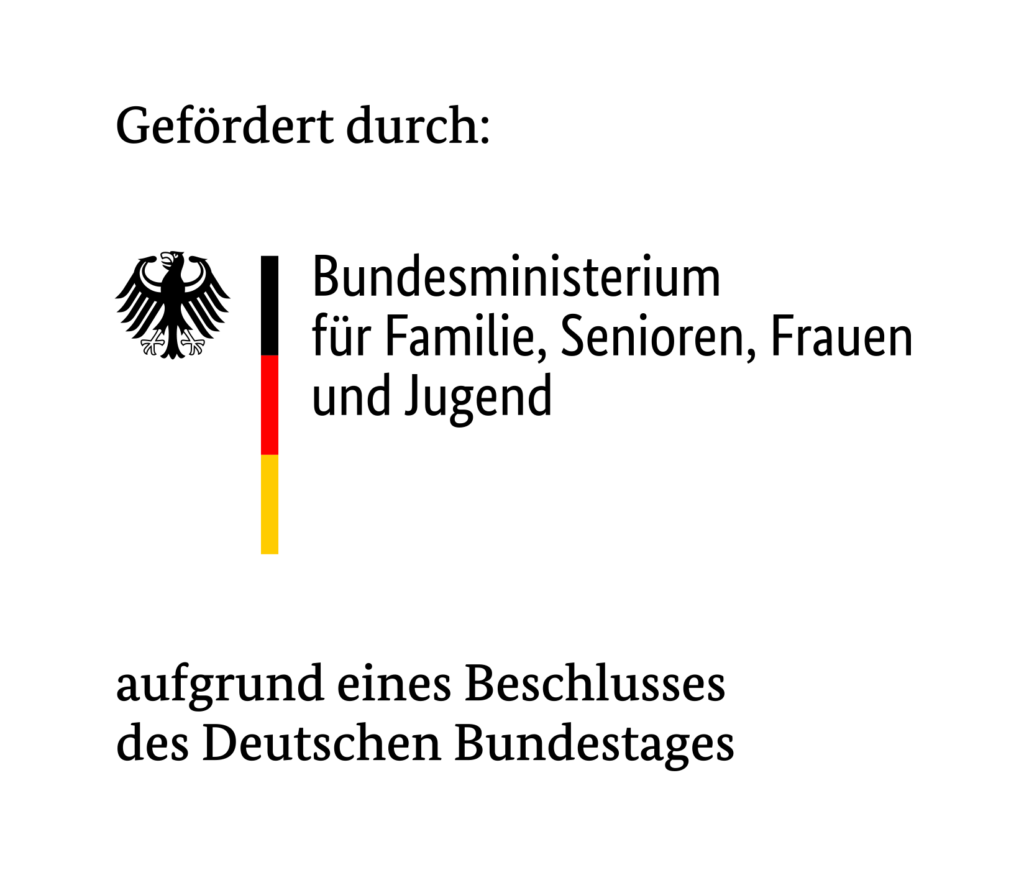Hier ein Beitrag unseres Praktikanten Carlo. Er ist 21, studiert Lehramt in Leipzig und war für einen Monat als Praktikant an der Demokratischen Schule X. Seine Gedanken beziehen sich noch auf unser altes Schulgebäude in Berlin-Heiligensee.

Ein paar Stationen mit der S-Bahn im Nordwesten Berlins, etwas außerhalb, umgeben von einigen Birken, einem Waldstück und dem Bahndamm liegt die Demokratische Schule X. Es ist keine große Schule, doch eine dafür umso lebendigere. Auch im Lockdown, in dem nur eine begrenzte Anzahl an Schüler*innen die Schule besucht, die Feste-Feiern AG auf Eis liegt und man im Unterricht oftmals nur über langsames Internet miteinander verbunden ist. Von Anfang an erscheint mir die DSX als eine starke Gemeinschaft, in der sich alle füreinander interessieren, ehrlich zueinander sind und Lust aufeinander haben. Ich erlebe sehr muntere und offene Schüler*innen. Insbesondere am Gebäude zeigt sich, wie sehr sich die Schüler*innen mit der Schule identifizieren: Die Räume sind von der Schulgemeinschaft gestaltet, ein großes Holz-X, von allen bemalt und signiert steht im Erdgeschoss, ein Wandgemälde ziert den Raum und andere Zeichnungen von Kindern hängen an den Wänden. Auf bunten Hinweiszetteln liest man Erinnerungen an Regeln (zum Beispiel die Dreck-wegmach-Regel), die von allen Mitgliedern der Gemeinschaft in der Schulversammlung beschlossen wurden. Rechtsstaatlich, heißt es im Schulkonzept – man könnte auch sagen basisdemokratisch.
Ganz im Gegensatz zu meiner (Regel-)schulzeit. Durch graue Flure schlappend und in tristen Klassenzimmern hockend gab es nur zwei Möglichkeiten: Die Lehrkraft als Autorität akzeptieren oder Rebellion. Der Unterricht war in der Regel langweilig, durch Zufall war selten mal ein Thema interessant. Anders an der DSX: Die Schüler*innen entscheiden selbst, welche Unterrichtsangebote sie besuchen und bieten auch selber welche an. Sitzen also zehn Schüler*innen im Geschichtsunterricht, kann man davon ausgehen, dass sich auch alle zehn dafür interessieren. So kam es beispielsweise, dass die Schüler*innen von selbst begannen, ihre Arbeitsergebnisse zusammenzutragen, während die Lehrkraft für einen Moment nicht im Raum war – in meiner Schulzeit beinahe undenkbar.
Dass die Schüler*innen machen können, was sie wollen (solange sie sich an die gemeinsam festgelegten Regeln halten), dass sie keinen Anweisungen oder Zwängen ausgesetzt sind, irritierte mich ehrlicherweise aber auch. Denn das bedeutet auch, dass manche Schüler*innen sich nicht mit Mathematik-, Deutsch- oder Siebdruckunterricht auseinandersetzen wollen, sondern lieber mit ihren Freund*innen Roblox spielen oder draußen toben. Letztendlich sind diese Tätigkeiten aber auch nur Ausdruck des kindlichen Interesses an der eigenen Umwelt. Dieses Interesse mündet zwangsläufig in Lernprozessen. Der entscheidende Unterschied liegt darin, ob dem Lernen eine Aufforderung zugrunde liegt, oder man sich selbst frei entschieden hat.
Das ist dabei gar nicht einfach. Auch bei mir selbst habe ich gemerkt, wie schwer eine Antwort auf diese simple Frage fällt: „Was möchte ich eigentlich machen?“ Manchmal habe ich mich dabei ertappt, wie ich mich regelrecht nach einer Aufgabenstellung gesehnt habe, die ich beklagen und anschließend stolz erledigen kann. Eigentlich ist es nicht nur eine simple, alltägliche Frage, sondern auch eine riesige. Sie ehrlich zu beantworten ist zentral im eigenen Leben. Gut, wenn man sich so früh wie möglich damit auseinandersetzen muss.